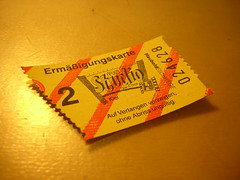Gedanken zur Abwrackprämie
Die letzten zwei Wochen haben M. und ich auf Europa-Tournee verbracht: Berlin (Bundestag), Nijmegen (Konzert Paolo Conte), Linz (Familie), Budapest (Familie, Parlament) und schließlich Debrecen (Familie). Alles in allem waren’s ungefähr 4.500 km, davon allein 1.300 km an einem Tag (Heimreise von Budapest nach Kiel).
Und das alles mit einem Panda, der während der Reise seinen 16. Geburtstag gefeiert hat. Da sage noch einer was über angeblich mangelhafte Qualität italienischer Autos. Dabei wäre der Kleine ja geradezu ein Bilderbuch-Kandidat für die staatliche Umwelt- bzw. Abwrackprämie (2.500 € bei Kauf eines Neuwagens). Dumm nur, dass der Verbrauch des Panda bei moderaten fünf bis sechs Litern auf 100 km liegt, die EURO 2-Abgasnorm erfüllt und somit auch in der Innenstadt deutscher Feinstaubmetropolen bewegt werden darf. Einen Vorteil für die Umwelt würde die Verschrottung also nicht bringen, soviel ist sicher.
Zur Abwrackprämie ist aber auch Positives zu vermelden. Wer in den letzten Wochen mal auf der Autobahn von Linz nach Budapest unterwegs war und den Gegenverkehr beobachtet hat, der kann auf den knapp 500 km problemlos einige 100 Autotransporter zählen, bestückt mit den besten Produkten der ost- und südosteuropäischen Autoindustrie. Neben einigen ungarischen Suzukis sind es hauptsächlich rumänische Dacias, deren Kauf vom deutschen Staat subventioniert wird. Und das ist in der Tat gut – für die Rumänen, die es wirtschaftlich und politisch in den letzten 20 Jahren längst nicht so gut hatten wie ihre sozialistischen Brüder in der Ex-DDR. Es sei ihnen also gegönnt.
Die Deutschen sind in der Tat ein merkwürdiges Volk. Finanziell rechnet sich die Abwrackprämie kaum: Wer nächstes Jahr – nach Auslaufen der Prämie – kauft, wird bei den dann wieder notleidenden Autohändlern einen kräftigen Rabatt bekommen und kann außerdem sein Altauto noch für ein paar 100 € verkaufen. Richtig strange ist aber das Verhalten dieses Käufers, über den heute die FAZ berichtete:
Vor dem Subaru-Autohaus fährt ein VW Käfer vor. Baujahr 1957, schon mit dem größeren Fenster hinten, über der Klappe, unter der die Uralt-Boxermaschine lärmt und stinkt. Der Subaru-Verkäufer ist begeistert und bietet dem Mann spontan 3500 Euro für die rollende Antiquität. Aber der VW-Fahrer ist eigensinnig. Er will, dass das Auto verschrottet wird. „Nach mir soll ihn keiner mehr fahren“, sagt der Mann und wartet, bis die Kennzeichen entfernt sind und er die Bescheinigung für die Verschrottung erhalten hat.
So etwas tut weh. Der Panda zumindest bleibt noch für ein paar Jahre, wenn er sich gut benimmt: 20 Jahre sollten insgesamt ja wohl drin sein.